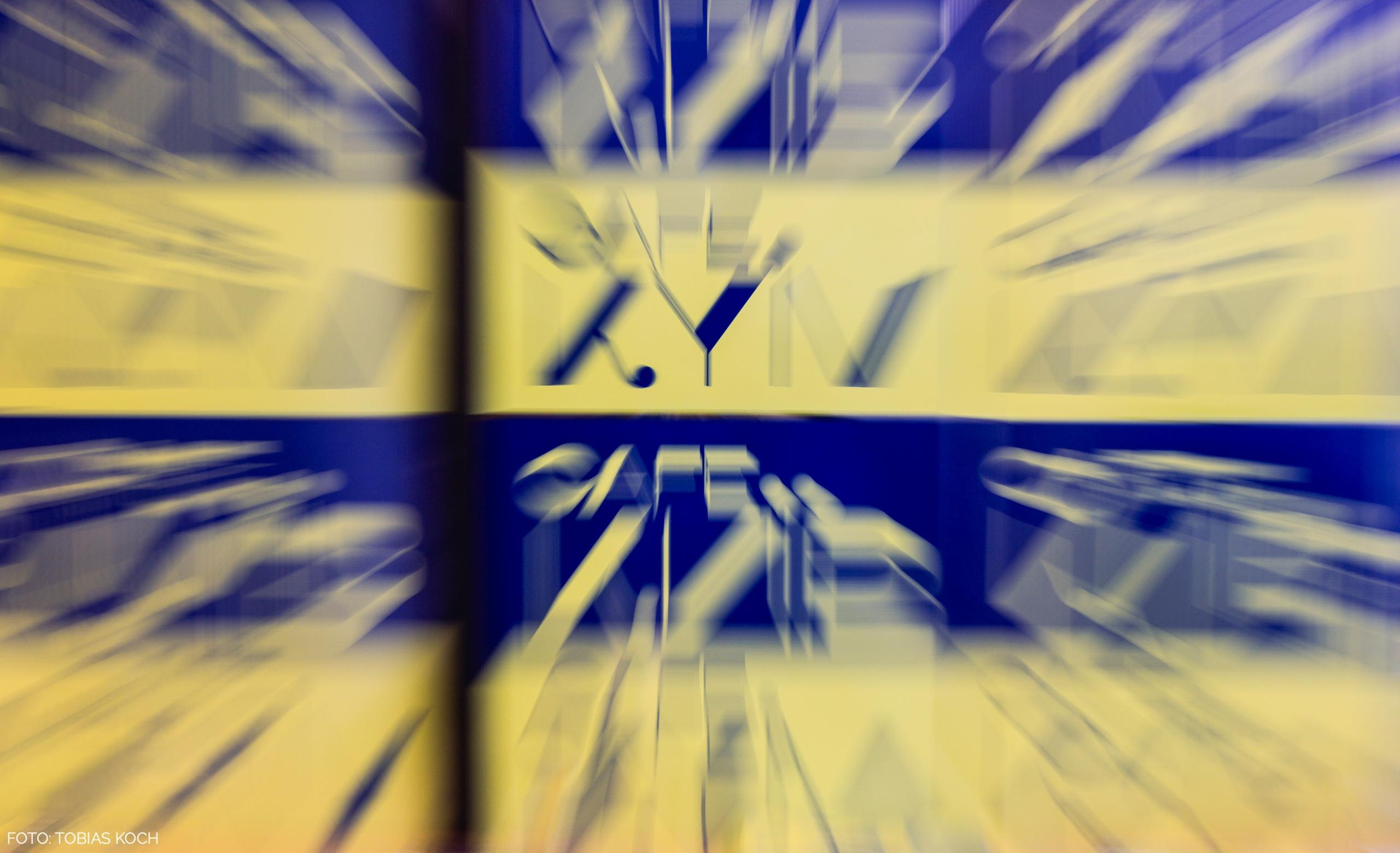Plattform Wiederaufbau Ukraine bei Café Kyiv 2025 Synergien für den Wiederaufbau: Was können Partnerschaften bewirken?
Der Stand von letztem Jahr im 1. Obergeschoss hat sich größentechnisch verdreifacht und auch inhaltlich ordentlich zugelegt: Besucher*innen können am Vormittag an den zwei Mini-Talks zum Themenkomplex Desinformation teilnehmen, die das Plattformsekretariat dort in Kooperation mit der DW Akademie anbietet. Vorgestellt werden ein E-Learning-Programm zu Desinformation (Tackling Disinformation: A Learning Guide (Externer Link)) und die digitale Toolbox „Colmena (Externer Link)“, die journalistische Arbeit unter Kriegsbedingungen ermöglicht. Die schnurlosen Headsets zum Verfolgen der Vorstellung sind schnell vergriffen.
Die Besucher*innen können sich aber auch über die Plattform und ihr großes Netzwerk von rund 2.000 Menschen in über 1.100 Organisationen informieren und gemeinsam mit dem Sekretariat der Plattform überlegen, wie sie sich selbst beim Wiederaufbau der Ukraine einbringen können.
Oder sie kommen am Nachmittag wieder und haben dort die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit insgesamt sechs spannenden Aktiven der Plattform zu gehen. Diese sechs, Julia Chenusha (Blau-Gelbes Kreuz), Nataliia Fiebrig (Ukraine2Power), Stefan Henkel (Europa-Universität Viadrina), Małgorzata Ławrowska-von Thadden (OBMIN), Lily Nabochenko (Mykolaiv Water Hub) und Alexander Tebbe (Crowd Ukraine) haben zuvor im Panel der Plattform zu „Synergien für den Wiederaufbau: Was können Partnerschaften bewirken?“ ihre Arbeit vorgestellt und, moderiert durch Andriy Garbuza von der Plattform, den rund 140 Veranstaltungsteilnehmenden ihre eigenen Erfolgsfaktoren und möglichen Stolpersteine bei der Durchführung von Kooperationsprojekten vermittelt.
Die Auswahl des Panels verdeutlicht klar die Arbeitsweise der Plattform: Es sind Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft, aus dem Privatsektor oder dem Kulturbereich, mit engen Verbindungen in die (kommunale) Politik. Ein diverses Panel, das voneinander lernen kann. Denn der Wiederaufbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wird im besten Fall in Kooperationen und im Austausch angegangen.
Lily Nabochenko vom Mykolaiv Water Hub (Externer Link) erklärt, dass sie gemeinsam mit ihren Kolleg*innen ein Ökosystem zu Wasser-, Energie- und Agrarlebensmittelthemen in der Südukraine aufbauen will. Dafür arbeitet sie beispielsweise daran, Mädchen und junge Frauen für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), zu begeistern. Nabochenko nennt Universitäten, lokale Wasserwerke, die Siemens Stiftung, die Stadt Hannover, enercity AG und auch die Plattform Wiederaufbau Ukraine als Akteur*innen, die das Ökosystem zum Leben erwecken. Bei Kooperationen sieht sie vor allem den Vorteil, dass man zeitgleich viel mehr erreichen kann. Sie erwähnt an der Stelle eine Veranstaltung der Plattform Wiederaufbau Ukraine im Juni 2024, bei der sich die Gründerin des Mykolaiv Water Hub und der Prothesenhersteller Horus Prosthetics aus Berlin kennengelernt haben. Ihr Ziel, ein Zentrum für Prothetik in Mykolajiw aufzubauen, geht 2025 in die nächste Phase.
Auch Alexander Tebbe arbeitet nicht allein. Sein Team bei Crowd Ukraine plant zusammen mit der GROPYUS AG (Externer Link) Wohngebäude in klimaneutraler Holzbauweise. Auch für ihn sind Partnerschaften essenziell, sowohl bei der Planung und Durchführung von Projekten in der Ukraine als auch in den Schritten davor, wenn es um finanzielle Fragen geht. Wichtig sei, sich mit der Lage vor Ort auseinanderzusetzen. Die Ukraine ist laut Tebbe geographisch gar nicht so weit von Deutschland entfernt, gedanklich bei einigen aber schon. Sein Fazit, um erfolgreiche Kooperationen und Projekte anzugehen: „Die Ukraine kann man nicht allein mit Spendengeldern wieder aufbauen. Und man kann nicht von der Ukraine sprechen, wenn man nicht vor Ort war. Vor Ort zu sein, ist auch eine vertrauensfördernde Maßnahme.“
„Der russische Angriff hat mich als Journalistin zur Non-Profit-Akteurin gemacht. Alles, was wir bisher vollbracht haben, haben wir in Partnerschaften gemacht.“ Nataliia Fiebrig von Ukraine2Power (Externer Link) setzt sich dafür ein, die Energieversorgungssicherheit und -effizienz in der Ukraine zu stärken. Und das in und von Deutschland aus, aber auch mit vielen lokalen Partner*innen in der Ukraine. Denn sie will nicht nur das notwendige Equipment liefern, sondern dieses vor Ort prüfen, warten und reparieren. Sie gibt den Zuhörer*innen drei Empfehlungen mit:
- Immer einen Plan B in der Schublade haben, um zum Beispiel auf den Ausfall eines Partners reagieren zu können.
- Gut kommunizieren und damit möglichen Missverständnissen vorbeugen.
- Konflikte nicht in der Öffentlichkeit austragen.
Dass Kooperationen zwischen Städten und Kommunen wichtige Erfolgsfaktoren sein können, betont Julia Chenusha vom Blau-Gelben Kreuz (Externer Link). So gab es zwar schon vor dem vollumfänglichen russischen Angriffskrieg 2022 zahlreiche Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und der Ukraine. Nach dem 24. Februar 2022 sei die Anzahl neuer Partnerschaften aber regelrecht in die Höhe geschossen. Ihr Verein stellt sicher, dass der Transport von Hilfsgütern aller Art – Generatoren, Container, Filter und Pumpen für die Wasserversorgung oder auch Medikamente – zuverlässig, schnell und transparent stattfindet und die Güter vor Ort ankommen. „Wir sind eine Brücke zwischen den kommunalen Partnerschaften“, resümiert Chenusha. Und weist darauf hin, dass es für erfolgreiche Kooperationen wichtig sei, die Extrameile gehen zu wollen. Es braucht nicht immer nur Geld, sondern auch die Bereitschaft aller Beteiligten, sich zu engagieren.
Eine wichtige Brücke ist auch die OBMIN-Stiftung (Externer Link): Die Plattform von derzeit 147 ukrainischen Museen ist das größte Netzwerk von Museen aus allen Teilen der Ukraine. OBMIN (Ukrainisch für „Zusammenarbeit“) wurde im Sommer 2022 von Małgorzata Ławrowska-von Thadden in Warschau gegründet und wird von zahlreichen Partner*innen – in Deutschland beispielsweise vom Auswärtigen Amt, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der GIZ GmbH sowie privaten Förderern – unterstützt. Ławrowska-von Thadden erklärt, dass Vernetzung von Anfang an die wichtigste Aufgabe von OBMIN war: All zwei Wochen treffen sich die Mitglieder online, lernen sich (besser) kennen und besprechen Herausforderungen für die Arbeit der Museen. Sowohl in Zeiten des Krieges als auch mit Blick auf ihre Rolle zur Stärkung der Zivilgesellschaft für die Zukunft der Ukraine. Zudem bringt OBMIN ukrainische Museen mit internationalen Partner*innen zusammen und hat, in Partnerschaft mit den Regierungen der Ukraine, Polens und Deutschlands internationale Konferenzen ermöglicht, auf denen die ukrainischen Museen gemeinsame Positionen zu ihren Aufgaben und ihrer Zukunft vorgestellt haben. Hier können Sie mehr darüber nachlesen.
Ein Erfolgsfaktor in dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit, den Ławrowska-von Thadden sieht: Durch die schwierige Anfangszeit habe man schnell zusammengefunden und dadurch Vertrauen aufgebaut. So konnten beispielsweise evakuierte Museen aus der Ostukraine zusammen mit Institutionen im Westen des Landes ihre Sammlungen digitalisieren und Ausstellungen konzipieren, ihre Arbeit somit aufrechterhalten.
Fährt man auf der Autobahn von Warschau nach Berlin, landet man unweigerlich in Frankfurt an der Oder und somit dem Sitz der Europa-Universität Viadrina-Universität, der Arbeitgeberin von Stefan Henkel: „Wir können sicher behaupten, dass wir an der Viadrina eine der größten Forschungs- und Lehrzentren zur Ukraine in Deutschland sind“.
Universitäten seien auch mit Blick auf die Entwicklung von transsektoralen Partnerschaften zentrale Akteur*innen des Wiederaufbaus, würden aber oft übergangen, so Henkel weiter. Auch für ihn sind Kooperationen sehr wichtig: So wurde an der Viadrina eine Vielzahl von Projekten aufgesetzt, die deutsche, polnische und ukrainische Forschende zusammenbringen und damit Perspektivwechsel erlauben. Für ihn zeigen sich erfolgreiche Kooperationen im Wissenschaftsbereich, wenn man weg von der projektbasierten hin zur strukturellen Zusammenarbeit kommt. Als Beispiel nennt er den Wissensaustausch auf verschiedenen Ebenen der Universität: Forschung, Lehre, aber auch Verwaltung oder Finanzen. Wichtig dabei ist vor allem das Lernen voneinander: z.B. sind „ukrainische Universitäten wahnsinnig gut in der Online-Lehre, da können sich die deutschen Universitäten eine große Scheibe abschneiden.“
Bevor sich alle wieder ins Getümmel von Café Kyiv begeben, bittet Andriy Garbuza noch um ein kurzes Fazit der Panelist*innen. „It takes a village to raise a child“, resümiert beispielsweise Julia Chenusha, Małgorzata Ławrowska-von Thadden gibt den Teilnehmer*innen mit, zuzuhören und dadurch viel voneinander zu lernen und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Alex Tebbe verbindet sein Fazit mit einem Lob an die Organisator*innen der Veranstaltung: „Es gibt häufig Redeveranstaltungen, wo nichts dabei rumkommt – aber das ist bei der Plattform Wiederaufbau Ukraine anders.“ Kurzum: (Gemeinsam) Anpacken!
Andriy Garbuza (Sekretariat der Plattform Wiederaufbau Ukraine), Lily Nabochenko (Mykolaiv Water Hub), Nataliia Fiebrig (Ukraine2Power), Alexander Tebbe (Crowd Ukraine), Julia Chenusha (Blau-Gelbes Kreuz), Małgorzata Ławrowska-von Thadden (OBMIN) und Stefan Henkel (Europa-Universität Viadrina) auf dem Panel „Synergien für den Wiederaufbau: Was können Partnerschaften bewirken?“